Wie du Gedankenkreisen erkennst, Grübelschleifen abstellst und wieder mehr Ruhe im Kopf findest.
30-Sekunden Zusammenfassung
- Gedankenkreisen bedeutet, immer wieder über dieselben belastenden Themen nachzudenken – ohne zu einer Lösung zu kommen.
- Typische Inhalte sind: Selbstkritik, Sorgen, Schuldgefühle oder Fragen wie „Was wäre gewesen, wenn …?“
- Grübeln hat seinen Ursprung in stressigen oder emotional belastenden Situationen – etwa nach Konflikten, Entscheidungen oder Enttäuschungen.
- Es entsteht ein Teufelskreis: Grübeln verschlechtert die Stimmung – und die schlechte Stimmung verstärkt das Grübeln.
- Hilfreich sind Strategien wie bewusste Grübelzeiten, Journaling, Bewegung, Achtsamkeit oder ein Gespräch mit einer vertrauten Person.
- Wenn du aufhörst, im Kreis zu denken und stattdessen neue Strategien ausprobierst, gewinnst du wieder mehr Kontrolle und Handlungsspielraum.
Was versteht man unter Gedankenkreisen?
Gedankenkreisen – das klingt erstmal harmlos. Ist es aber nicht immer. Besonders dann nicht, wenn es sich um wiederkehrendes Grübeln handelt und du es nicht schaffst, das Gedankenkarussell zu stoppen.
Damit ist gemeint: Du denkst immer wieder über dieselben belastenden Dinge nach – über
- Schuld,
- das abstrakte „Warum?“,
- Entscheidungen oder Situationen, die du nicht mehr beeinflussen kannst.
Und je mehr du grübelst, desto schlechter fühlst du dich.
Grübeln ist dabei kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil – es ist dein Versuch, mit einer Situation klarzukommen. Der Kopf sucht nach einer Erklärung oder Lösung.
Doch genau das kann dazu führen, dass konkrete Lösungen oder neue Perspektiven aus dem Blick geraten. Statt Klarheit entsteht ein innerer „Dauerkreisverkehr“ – ohne Richtung, ohne Ziel.
Die Forschung zeigt: Wenn Grübeln über längere Zeit anhält, kann es die Stimmung stark belasten – und sogar deine psychische Gesundheit gefährden.
Nicht jede Art von kreisenden Gedanken ist gleich Grübeln. Manche Menschen sorgen sich ständig um die Zukunft („Was, wenn …?“), andere erleben Gedanken, die ungebremst durch den Kopf rasen – etwa bei innerer Unruhe oder ADHS.
Nach belastenden Erfahrungen können auch Flashbacks auftreten – intensive Erinnerungen, die sich aufdrängen wie ein innerer Film. Und es gibt Zwangsgedanken: Beunruhigende, verstörende Inhalte, die nichts mit dem eigenen Wollen zu tun haben.
Tatsächlich können sich wiederkehrende Gedanken auch konstruktiv zeigen. Etwa, wenn du einen Plan schmiedest, um ein konkretes Ziel zu verfolgen. Entscheidend ist, ob das Denken dich weiterbringt – oder im Kreis führt.
In diesem Artikel soll es aber vor allem um das Grübeln gehen: Das zähe, kreisende Denken über dieselben schwierigen Themen, das dich festhält – und erschöpft.
Typische Inhalte von Grübelschleifen
Grübeln fühlt sich oft unkontrollierbar an. Trotzdem dreht es sich inhaltlich meist um bestimmte Themen.

Studien zeigen: Viele Menschen grübeln über ganz ähnliche Dinge – und das in Wiederholungsschleifen.
Vielleicht findest du dich in einer oder mehrerer Grübelschleifen hier wieder?
- Selbstkritik:
o „Ich mache alles falsch.“
o „Was stimmt eigentlich nicht mit mir?“
- Rückblick auf Vergangenes:
o „Warum habe ich das gesagt?“
o „Hätte ich mich damals anders entschieden …“
- Katastrophisierungen:
o „Das wird nie besser.“
o „Was, wenn alles noch schlimmer wird?“
- Sozialer Vergleich:
o „Alle anderen kriegen ihr Leben auf die Reihe – nur ich nicht.“
o „Warum bin ich nicht so stark wie sie?“
- Unlösbare Warum-Fragen:
o „Warum passiert das immer mir?“
o „Warum klappt bei mir nichts?“
- Sinnsuche im Schmerz:
o „Was soll das alles überhaupt?“
o „Ich verstehe einfach nicht, warum das passiert.“
Solche Gedanken wirken, als müsste man ihnen folgen. Sie fordern dich regelrecht auf, sie weiter zu zerdenken. Aber am Ende führen sie selten zu Klarheit – weil es keine eindeutige Antwort auf sie gibt. Sie ziehen dir Energie und machen es schwer, innerlich zur Ruhe zu kommen.
Warum kreisen die Gedanken?
Gedankenkreisen beginnt nicht einfach so – ohne Grund. Sondern: Die Gedanken verrennen sich meist in Momenten, in denen etwas schiefläuft oder du verunsichert bist.
In anderen Worten: Das Grübeln setzt dort an, wo etwas innerlich nicht rund ist. Wo eine Lücke bleibt zwischen dem, wie es ist – und dem, wie es hätte sein sollen.
Typische Auslöser für Grübeln sind:
- Ein Ziel wird nicht erreicht
- Ein Konflikt bleibt ungelöst
- Etwas widerspricht dem eigenen Selbstbild
- Eine Entscheidung fühlt sich im Nachhinein falsch an
Der Verstand will verstehen, was passiert ist. Er sucht nach einem Sinn – auch wenn es den manchmal gar nicht gibt.
Grübelverstärker: Warum der Kopf nicht zur Ruhe kommt
Psycholog:innen haben untersucht, unter welchen Umständen Menschen eher zu Gedankenkreisen neigen:
- Wir denken nach – weil wir nicht verstehen: Das Bedürfnis, eine belastende Situation zu durchdringen, ist sehr stark. Wer etwas nicht einordnen kann, grübelt eher. In der Hoffnung, irgendwann eine Erklärung zu finden.
- Wir grübeln – weil es uns nah geht: Je persönlicher uns ein Erlebnis berührt, desto mehr Raum nimmt es im Kopf ein. Es wird bedeutungsschwer und dadurch schwer loszulassen.
- Wir suchen Gründe – weil wir es so gewohnt sind: Manche Menschen analysieren automatisch. Sie suchen nach Mustern und fragen sich: „Warum?“. Auch dann, wenn es keine hilfreiche Antwort gibt.
Ein Beispiel: Du möchtest mit einigen Freunden einen Urlaub planen. Im Gruppenchat hat dir auf deine letzte Nachricht niemand geantwortet. Du fühlst dich unsicher, fragst dich, was du hättest anders schreiben sollen – oder kreist um das „Warum“. Möglicherweise drängen sich in dein Grübeln auch selbstkritische Gedanken wie „Keiner mag mich“ oder „Wollen sie mich ausschließen?“. Dadurch wird deine Stimmung noch schlechter.
Du versuchst, mit dem inneren Stress klarzukommen – über den kognitiven Weg.
Statt konkrete Lösungen zu verfolgen, verharren Grübler aber häufig im Analysieren, Hinterfragen und Vergleichen. So kann ein ursprünglich sinnvoller Denkprozess ins ständige Kreisen abdriften.
Gedankenspirale: Was Grübeln am Laufen hält
In Momenten innerer Verunsicherung greifen verschiedene psychologische Faktoren ineinander und halten das Gedankenkreisen in Gang.
Laut Verhaltensforschung gehören dazu vier wichtige Mechanismen, die das Gedankenkreisen in Schwung halten:
- Stimmung färbt Gedanken ein. Wenn deine Stimmung gedrückt ist, denkt das Gehirn eher in sogenannten “dunklen” Tönen: Das Gehirn erinnert leichter frühere Misserfolge oder Konflikte. Psycholog:innen sprechen vom Stimmungskongruenz-Effekt: Deine Stimmung beeinflusst, welche Gedanken dir einfallen.
- Zweifel füllen die Lücken. In mehrdeutigen Situationen neigen viele Menschen dazu, das Negative zu interpretieren. Ein ausbleibender Anruf? „Bestimmt bin ich nicht wichtig.“ Grübeln verstärkt diesen Denkstil – und umgekehrt.
- Das sogenannte kognitive Dreieck zeigt, wie sich Gedanken, Gefühle und Verhalten gegenseitig beeinflussen: Ein negativer Gedanke („Ich gehöre nicht dazu“) kann ein Gefühl der Niedergeschlagenheit auslösen. Das wiederum führt vielleicht dazu, dass man sich zurückzieht und/oder noch mehr negative Gedanken aufkommen. So schaukeln sich die drei Ebenen gegenseitig auf.
- Ein Teufelskreis entsteht. Schlechte Stimmung fördert Grübeln – Grübeln verstärkt die schlechte Stimmung. Und je länger dieser Kreislauf andauert, desto schwerer wird es, ihn zu durchbrechen.
Grübeln ist also der Versuch, Ordnung ins innere Chaos zu bringen. Ein gedanklicher Bewältigungsversuch. Aber einer, der sich häufig selbst im Weg steht.
Tipps bei Gedankenkreisen
Grübeln scheint, als würde es dir helfen – in Wahrheit hält es dich fest. Doch du kannst lernen, den Kreislauf zu unterbrechen und neue Wege im Denken einzuschlagen.
Die folgenden Strategien zeigen dir, wie das gelingen kann.
Die Sinnhaftigeit von Grübeln hinterfragen
Viele Menschen glauben insgeheim, dass Grübeln irgendwie hilft.
- „Wenn ich lange genug nachdenke, finde ich schon eine Lösung.“
- „Ich muss das verstehen, sonst werde ich nie damit abschließen.“
Diese Gedanken geben dir das Gefühl, die Kontrolle zu behalten. Doch die Wahrheit ist: Grübeln führt selten zu Klarheit – dafür häufig zu noch mehr Grübeln.
Frag dich deshalb ehrlich:
Bringt mich das Grübeln weiter – oder drehe ich mich im Kreis?
Probiere folgendes Mini-Experiment:
Notiere eine Überzeugung, die du über das Grübeln hast – zum Beispiel „Grübeln hilft mir, meine Fehler nicht zu wiederholen.“
Bewerte dann, wie sehr du an diesen Satz glaubst (0–100 %).
Und beobachte:
- Stimmt das wirklich?
- Oder fühlt sich das Grübeln nur nützlich an, ohne es zu sein?
Manchmal ist allein diese Frage der erste Schritt, um das Gedankenkarussell zu verlangsamen.
Journaling
Schreiben unterbricht das Grübeln – und schafft Abstand. Du musst kein seitenlanges Tagebuch führen.
Ein paar Sätze reichen:
- Was beschäftigt mich gerade?
- Welche Gedanken tauchen immer wieder auf?
- Wie fühlt sich das körperlich und emotional an?
Mach das regelmäßig – zum Beispiel abends. Ein Notizbuch am Bett hilft, Grübelschleifen frühzeitig zu stoppen. Du musst nichts analysieren. Es reicht, wenn du Gedanken loswirst, bevor sie dich festhalten.
Das Journaling wirkt für dein Gehirn wie ein Ventil und hilft dir dabei, die Gedanken in das Notizbuch zu “verbannen”. Stelle dir beim Journaling vor, wie du deine kreisenden Gedanken in Schriftform überträgst – und so los wirst.
Individuelles Grübelmuster erkennen
Bevor du das Grübeln stoppen kannst, musst du es erstmal erkennen.
Ein hilfreicher erster Schritt ist deshalb, sich selbst ein bisschen wie ein:e Forscher:in zu beobachten:
Wann grübelst du? Worüber? Wie fühlt sich das körperlich an? Und welche Gedanken kehren immer wieder?
Typische Anzeichen für problematisches Grübeln sind zum Beispiel:
- Du drehst dich gedanklich im Kreis – ohne zu einer Lösung zu kommen.
- Du stellst dir viele „Warum“-Fragen, auf die es keine zufriedenstellende Antwort gibt.
- Das Grübeln raubt dir Zeit, Energie und Aufmerksamkeit für andere Dinge.
- Du merkst, dass dich das Ganze emotional und körperlich belastet – vielleicht fühlst du dich angespannt, niedergeschlagen oder erschöpft.
Tipp: Mach dir in einer ruhigen Minute Notizen zu deinen persönlichen Grübel-Auslösern.
Allein dieses bewusste Hinsehen kann helfen, eine gesunde innere Distanz zu den Gedanken zu entwickeln – und im nächsten Schritt gezielt gegenzusteuern.
Und keine Sorge: Du musst deine Gedanken nicht „unter Kontrolle“ bringen. Es reicht, wenn du sie rechtzeitig bemerkst.
Unterbrich dein Grübelmuster
Wenn du dein Grübeln schon ein paar Mal bewusst beobachtet hast, wirst du merken: Es gibt meist eine Art „Startsignal“ – also eine bestimmte Situation, ein Gefühl oder einen Gedanken, der das Gedankenkarussell anschiebt.
Vielleicht ist es der Moment, wenn du dich abends aufs Sofa setzt. Oder ein flüchtiger Gedanke wie: „Warum hab ich das damals bloß so gesagt?“
Dieses Startsignal ist dein Grübelauslöser – und ihn zu erkennen, ist Gold wert.
Denn genau hier setzt der nächste Schritt an: Grübeln ist ein erlerntes, automatisiertes Reaktionsmuster – und was gelernt ist, lässt sich auch umlernen.
Der Schlüssel: Du brauchst eine neue, hilfreiche Reaktion, die das alte Muster durchbricht. Ein kleines, bewusstes Gegenritual.
Hier ein paar Ideen, wie so eine neue Reaktion aussehen kann:
- Sag innerlich „Stopp!“ – oder auch laut, wenn du allein bist. Diese kleine Geste schafft einen Moment der Unterbrechung.
- Bewege dich. Steh auf, geh ein paar Schritte, streck dich oder mach eine kurze Yoga-Sequenz.
- Nutze einen Duftanker. Ein Lieblingsduft (z. B. ätherisches Öl auf dem Handgelenk) kann helfen, deine Aufmerksamkeit zurück in den Moment zu holen.
- Visualisiere deinen Kraftort. Stell dir einen Ort vor, an dem du dich sicher und ruhig fühlst – egal ob real oder ausgedacht. Verweile gedanklich für ein paar Atemzüge dort.
Wichtig: Es geht nicht darum, das Grübeln zu unterdrücken. Vielmehr trainierst du dein Gehirn darauf, eine neue Spur einzuschlagen, sobald der alte Autopilot anspringt. Am Anfang braucht das etwas Übung – aber je öfter du dein Muster unterbrichst, desto leichter wird es mit der Zeit.
Verschieb das Grübeln: Der „Grübelstuhl“
Grübeln fühlt sich oft so an, als hätte man keine Wahl. Ein Gedanke kommt – und nimmt dich sofort mit. Das stimmt allerdings nicht ganz.
Was dir Abhilfe verschaffen kann, ist der Gedankenaufschub – auf einen festen Zeitpunkt später am Tag.
Wie das geht? Ganz einfach: Wenn du merkst, dass du dich im Gedankenkarussell verlierst, sag dir innerlich: „Stopp – darum kümmere ich mich heute Abend um 18 Uhr!“
Wichtig: Du verbietest dir das Grübeln nicht. Du verschiebst es nur – auf eine festgelegte „Grübelzeit“. Die kann zum Beispiel zehn Minuten am späten Nachmittag sein (nicht direkt vor dem Schlafengehen!).
Und hier kommt der Clou: Richte dir dafür einen Grübelstuhl ein – einen Ort, an dem du deine Grübelgedanken parken darfst. Das kann ein ganz realer Stuhl in deiner Wohnung sein, den du dafür symbolisch nutzt. Oder ein imaginärer Ort in deiner Vorstellung.
Warum das funktioniert?
Du schaffst Abstand zwischen dir und deinen Gedanken. Grübeln fühlt sich weniger überwältigend an.
Vielmals zeigt sich: Wenn die Grübelzeit dann kommt, erscheinen dir viele Sorgen kleiner – oder du denkst klarer und konstruktiver darüber nach.
Du musst übrigens während deiner Grübelzeit nicht wirklich grübeln. Du darfst – wenn dir danach ist.
Allein die Tatsache, dass du wieder entscheidest, wann du dich mit schwierigen Gedanken beschäftigst, gibt dir ein Stück Kontrolle zurück.
Probiere es eine Woche lang aus – und schau, wie sich dein Verhältnis zu deinen Gedanken verändert. Viele merken schon nach wenigen Tagen: „Ich habe mehr Einfluss auf mein Denken, als ich dachte.“
Achtsamkeit
Glaubst du deinen Gedanken manchmal, als wären sie die absolute Wahrheit? Manchmal fühlen sie sich so echt an, dass man gar nicht merkst: Es sind Gedanken – keine Fakten.
Gerade beim Grübeln nehmen Betroffene bestimmte Sätze besonders ernst:
- „Ich bin nicht gut genug.“
- „Das wird nie besser.“
- „Ich krieg das einfach nicht hin.“
Achtsamkeit hilft dir, einen Schritt zurückzutreten, anstatt immer tiefer in diese Gedanken hineingezogen zu werden. Du lernst, Gedanken als das zu sehen, was sie sind: Innere Ereignisse, die kommen – und auch wieder gehen.
Eine einfache Achtsamkeitsübung:
Stell dir vor, du sitzt ruhig an einem Fluss. Deine Gedanken sind Laubblätter, die auf der Wasseroberfläche treiben. Auf einem steht: „Alle anderen schaffen das, nur ich scheitere ständig.“, auf dem nächsten: „Ich bin nicht gut genug.“ Du siehst sie kommen – und lässt sie weiterziehen, ohne sie festzuhalten oder zu bewerten. Manche treiben schnell vorbei, andere langsamer. Und das ist okay.
Du musst nichts tun – nur beobachten.
Es geht nicht darum, deine Gedanken loszuwerden. Es geht darum, ihnen mit etwas mehr Abstand zu begegnen.
Dieser kleine Abstand verändert viel: Grübeln wirkt weniger überwältigend. Du gewinnst mehr Ruhe – und ein Stück innerer Freiheit.
Wichtig: Achtsamkeit ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Eine einzelne Übung im Grübelmoment wirkt meist nur begrenzt. Deshalb: Übe regelmäßig, vor allem in ruhigen Momenten. So lernt dein Gehirn, auch im Stress leichter auf Abstand zu gehen.
Radikale Akzeptanz
Grübeln entsteht, wenn du versuchst, innerlich gegen etwas anzukämpfen, das sich nicht mehr ändern lässt: Eine Entscheidung, die du bereust. Ein Streit, den du nicht ungeschehen machen kannst. Ein Gefühl, das einfach nicht verschwinden will.
- „Hätte ich damals nur …“
- „Warum war ich nicht …“
- „Was wäre, wenn …“
Das Problem: Je mehr du versuchst, solche Gedanken und Gefühle zu bekämpfen oder wegzudrücken, desto mehr holen sie dich ein. So, als würdest du einen Wasserball unter Wasser drücken – der kommt irgendwann mit Wucht zurück.
Radikale Akzeptanz ist ein anderer Weg: Es geht darum, den inneren Widerstand loszulassen.
Dir selbst zu erlauben: „Ja, das ist passiert. Ja, das tut weh. Und ich höre auf, dagegen anzukämpfen.“
Diese Haltung entlastet. Sie schafft Raum. Und sie hilft dir, aus dem endlosen Grübeln herauszukommen – weil du aufhörst, das Unveränderbare verändern zu wollen.
Das heißt nicht, dass du etwas gutheißen musst. Es bedeutet auch nicht, dich mit allem abzufinden.
Eine kleine Übung:
Such dir einen Satz, den du dir selbst innerlich sagen kannst, wenn das Gedankenkarussell wieder losgeht.
Zum Beispiel:
- „Es ist, wie es ist – und ich darf mich trotzdem gut um mich kümmern.“
- „Zulassen – loslassen.“
- „Was war, ist vorbei. Ich lebe jetzt.“
Diese Sätze sind kein Allheilmittel. Aber sie können dir helfen, dich wieder im Hier & Jetzt zu verankern – und dich nicht mehr im Kopf zu verlieren.
Bewegung
Grübeln hält dich in einem Zustand fest, in dem sich alles im Kopf abspielt – aber nichts in Bewegung kommt. Und genau deshalb ist körperliche Aktivität so hilfreich: Sie bringt den Fokus vom Denken ins Tun.
Wer sich regelmäßig bewegt, grübelt weniger.
Eine große Studie mit Studierenden ergab: Je häufiger und intensiver sich jemand körperlich betätigte, desto seltener verfiel die Person ins Grübeln.
Was wäre heute ein erster Schritt für dich?
- Ein ausgedehnter Spaziergang am frühen Abend?
- Ein paar Minuten locker tanzen zu deinem Lieblingslied?
- Oder eine kurze Yogaeinheit?
Es geht nicht darum, sportliche Leistung zu erbringen. Sondern darum, eine neue Richtung einzuschlagen – raus aus dem Kopf, rein in den Körper.
Zeit mit Freunden oder Familie
Manchmal hilft nicht nur, was du tust – sondern mit wem du es tust. Wenn du allein mit deinen Gedanken bleibst, wirken sie größer, wahrer oder bedrohlicher, als sie eigentlich sind.
Gespräche durchbrechen das. Nicht, weil sie sofort Lösungen liefern. Sondern weil sie dich zurückholen – raus aus dem inneren Monolog, rein in den Kontakt. Ins Hier und Jetzt.
Die Forschung zeigt: Gespräche und ein Gefühl von Verbundenheit mit anderen Menschen mildern die negativen Folgen von Grübeln ab.
- Trotz Grübeleien hatten die Personen, die sich regelmäßig mit Freunden austauschten, seltener depressive Verstimmungen.
- Und wer sich gut mit seinem Partner oder seiner Partnerin verbunden fühlte, schlief besser, obwohl die Gedanken kreisten.
Das bedeutet nicht, dass du alles aussprechen musst. Manchmal reicht es schon, gemeinsam zu schweigen, einen Spaziergang zu machen oder kurz zu erzählen, was dich gerade beschäftigt.
Manche Gedanken verlieren jedoch an Gewicht, sobald sie ausgesprochen sind. Und manchmal reicht schon ein Satz wie: „Klingt gerade echt schwer.“ – um wieder Luft zu bekommen.
Coaching oder Therapie
Nicht immer reicht es, mit vertrauten Menschen zu sprechen. Gerade wenn sich das Grübeln über längere Zeit festsetzt, die Stimmung drückt oder alltägliche Dinge schwerfallen, kann zusätzliche Unterstützung sinnvoll sein.
Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Im Gegenteil: Es zeigt, dass du dir selbst wichtig genug bist, um gut für dich zu sorgen.
Anhaltendes Grübeln kann das Risiko für depressive Symptome erhöhen, da ist sich die Forschung weitestgehend einig. Professionelle Begleitung kann entlasten – und dir helfen, neue Perspektiven und Strategien zu entwickeln.
In einem Coaching kannst du lernen, deine Denkmuster bewusster zu hinterfragen und lösungsorientiert an deine Probleme heranzugehen.
In einer Therapie kann es darum gehen, tieferliegende Ursachen zu verstehen und emotionale Belastungen zu verarbeiten.
Du musst nicht warten, „bis es richtig schlimm ist“. Manchmal reicht schon ein erstes Gespräch, um neue Klarheit zu gewinnen – und zu merken: Ich darf gut für mich sorgen.
Wichtig: Informiere dich zu den Ansätzen und frage dich, was aktuell besser zu deiner Situation passt, denn: Es gibt bedeutsame Unterschiede zwischen Coaching und Therapie.
Fazit
Grübeln ist anstrengend – und meistens wenig hilfreich. Es fühlt sich so an wie Nachdenken, ist aber ein endloses Kreisen um offene Fragen, Selbstzweifel und ungelöste Geschichten.
Wer viel grübelt, versucht meistens, Klarheit zu finden. Doch das Denken bleibt stecken oder führt ins Nichts: statt zu handeln, analysierst du weiter – und wirst dabei immer erschöpfter.
Was hilft?
- Erkennen, wann das Gedankenkarussell beginnt.
- Es bewusst unterbrechen – mit Bewegung, einem klaren „Stopp“, einer kleinen Veränderung im Alltag.
- Gedanken nicht sofort ernst nehmen, sondern mit Abstand betrachten.
- Sie aufschreiben. Verschieben.
- Beobachten, statt festhalten.
- Manchmal auch: Sprechen – mit einem Freund, der zuhört.
- Oder mit einem Coach, der hilft, Muster zu verstehen.
Grübeln hört nicht auf, weil du „stärker“ bist. Sondern weil du neue Wege gehst und so das Grübelmuster durchbrichst.


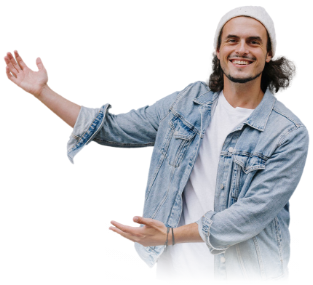
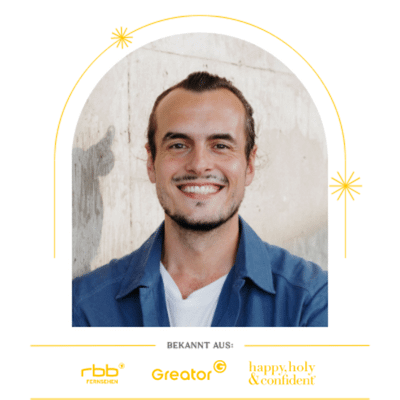



0 Kommentare